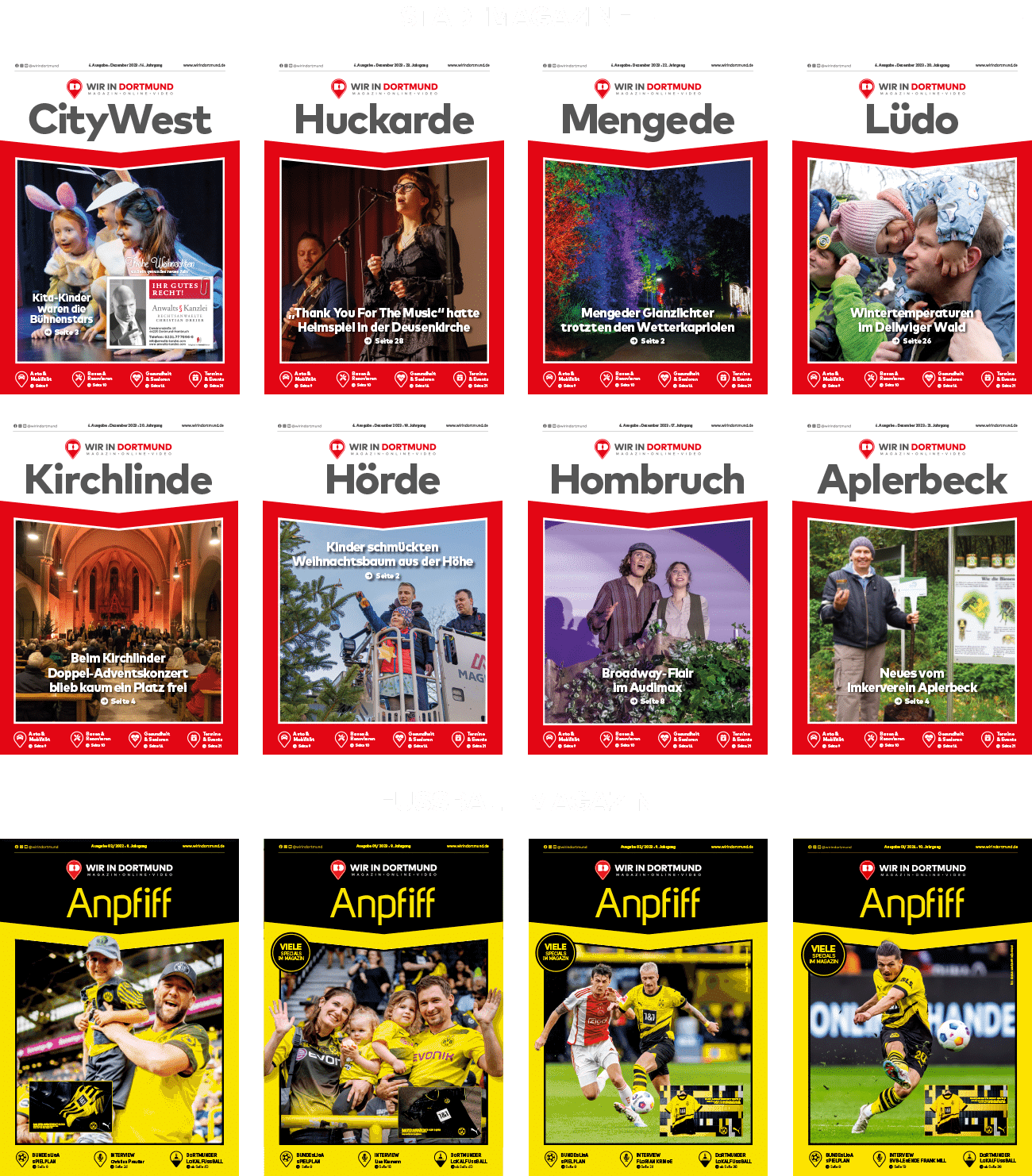Das Umweltamt hat verschiedene Förderprogramme zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung aufgelegt, mit der Maßgabe, möglichst vielen Menschen Zugang zu diesen Programmen zu ermöglichen. Verständliche, bürgernahe und niederschwellige Antragsverfahren sind aus Sicht der Verwaltung eine wichtige Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen.
Für die folgenden sechs Förderprogramme wurden Vorschläge entwickelt, über die der Rat in seiner Sitzung am 15. Juni entscheiden wird. Darin geht es neben der bereits genannten Niederschwelligkeit auch um Laufzeiten und die Fördersummen selbst.
Förderprogramm Dachbegrünung:
Dieses Förderprogramm dient dazu, die Entsiegelung privater Flächen und die Begrünung von Dächern voranzutreiben. Das bestehenden Förderprogramm zur Dachbegrünung und Entsiegelung wurde von Dortmunds Bürger*innen stark nachgefragt und soll mehrfach hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit und Verständlichkeit überprüft und angepasst werden. Es wird vorgeschlagen, das bereits eingeführte und etablierte Förderprogramm mit den neu beschlossenen Mitteln zur Dachbegrünung aufzustocken. Zudem sollen die Fördermittel auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 verteilt werden. Die verfügbaren Mittel aus den Beschlüssen zu den Haushaltsplänen 2022 und 2023 können mit dem vorhandenen Personal nicht verausgabt werden. Zudem bietet das Splitting des Fördergeldvolumens die Chance, kontinuierlich ein kommunales Förderprogramm für Begrünungsmaßnahmen bereit zu stellen.
Förderprogramm Photovoltaik (PV):
In den Genuss dieser Förderung kämen vor allem Gebäudeeigentümer*innen von Ein- und Zweifamilienhäusern. In diesem Segment gibt es eine große Nachfrage, die zum Teil die Möglichkeit der praktischen Umsetzung aufgrund von Lieferengpässen und Fachkräftemangel übersteigt. Zudem bildet die vorgesehene Maximalförderung von 1.000 Euro keinen echten Anreiz, um eine Investition in PV im Ein- und Zweifamilienhausbereich anzustoßen. Ein so ausgestaltetes Förderprogramm würde v. a. eine Mitnahmeförderung auslösen. Vorgeschlagen wird daher, ein Förderprogramm für PV im privaten Mehrfamilienhausbereich mit einer höheren Maximalförderung aufzulegen. Hier könnte eine Förderung einen Anschub von Investitionen und nennenswerten Zubau von PV-Anlagen auslösen. Gleichzeitig bietet sich damit die Möglichkeit der Entwicklung von Mieterstrommodellen, die Mieter*innen einen Zugang zu günstigeren Stromtarifen eröffnen. Auf die Festlegung einer Einkommensgrenze als Voraussetzung für einen positiven Förderbescheid soll aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand verzichtet werden.
Da die Förderrichtlinie noch erarbeitet werden muss und die personellen Ressourcen für die Förderantragsbearbeitung begrenzt sind, sollen die vorgesehenen Haushaltsmittel auf die Jahre 2023 bis 2025 verteilt werden.
Förderung energetische Sanierung:
Die bisherigen Erfahrungen z. B. aus dem Stadterneuerungsgebiet Unionviertel zeigen, dass ein entscheidender Impuls für energetische Sanierungen von Förderungen auf Zuschussbasis ausgeht. Gerade für die große Anzahl der privaten Gebäudeeigentümer*innen insbesondere im Mehrfamilienhausbereich sind die notwendigen Investitionen sonst oft finanziell nicht leistbar und wirtschaftlich unattraktiv. Aufgrund der kurzen Zeitspanne bis zum anvisierten Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2035 ist eine prozentuale Zunahme der energetischen Modernisierung unbedingt erforderlich. Um einen effektiven Anreiz zur Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen im Mehrfamilienhaussegment zu erzielen, sollte eine entsprechende, Gewerke bezogene und an der Treibhausgasreduzierung bemessene Förderung aufgelegt werden. Die Bewilligung der Förderung sollte an eine sozial gerechte Mietpreisbindung geknüpft werden. Da die Förderrichtlinie noch erarbeitet werden muss und die personellen Ressourcen für die Förderantragsbearbeitung begrenzt sind, sollen die vorgesehenen Haushaltsmittel auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt werden.
Fortsetzung Förderprogramm Geothermie:
Das Förderprogramm Geothermie wurde bislang gut angenommen und wird fortgesetzt. Auch hier gilt: Da die personellen Ressourcen für die Förderantragsbearbeitung begrenzt sind, sollen die vorgesehenen Haushaltsmittel auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt werden.
Förderung von Mini-Photovoltaikanlagen:
Ein entsprechendes Programm wird erarbeitet. Der Energiesparservice der Caritas wird in die Bewerbung des Programms mit eingebunden. Da die Förderrichtlinie noch erarbeitet werden muss und die personellen Ressourcen für die Förderantragsbearbeitung begrenzt sind, sollen die vorgesehenen Haushaltsmittel auf die Jahre 2023 bis 2025 verteilt werden.
Förderung von Wärmepumpen:
Mit dem Förderprogramm zur Geothermie existiert bereits ein städtisches Förderprogramm zur Förderung Geothermie betriebener Wärmepumpen. Dies ermöglicht eine zusätzliche Förderung zum Angebot des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und bildet somit einen Anreiz und eine Unterstützung für den Personenkreis, der die hohen Investitionskosten für diese Anlagen sonst nicht oder nur schwer aufbringen kann. Für Luft-Wasser-Wärmepumpen hält die BAFA ähnliche Förderkonditionen vor. Das städtische Förderprogramm für Wärmepumpen sollte analog der Geothermieförderung aufgesetzt werden, um auch in diesem Bereich eine Unterstützung zu den hohen Investitionskosten zur Verfügung zu stellen. Auf die Festlegung einer Einkommensgrenze als Voraussetzung für einen positiven Förderbescheid wird verzichtet. Die Prüfung von Einkommens-, Gehalts- und Vermögensnachweisen führt zu einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand, für den die personellen Ressourcen nicht vorhanden sind und widerspricht dem Anspruch einer niederschwelligen Förderrichtlinie.
Gesamtförderung bis 2027 beträgt 3,5 Mio. Euro
Die Gesamtfördersumme beträgt bis zum Jahr 2027 insgesamt rund 3,5 Mio. Euro. Sobald die Förderprogramme entwickelt und vom Rat beschlossen wurden, werden Sie jeweils in einer eigenen Pressemitteilung angekündigt und sind dann unter https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/planen_bauen_wohnen/dlze/foerderprogramme/index.html abrufbar.
Die Betreuung der Förderprogramme inklusive Beratung wird durch das städtische dlze – Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz gewährleistet.