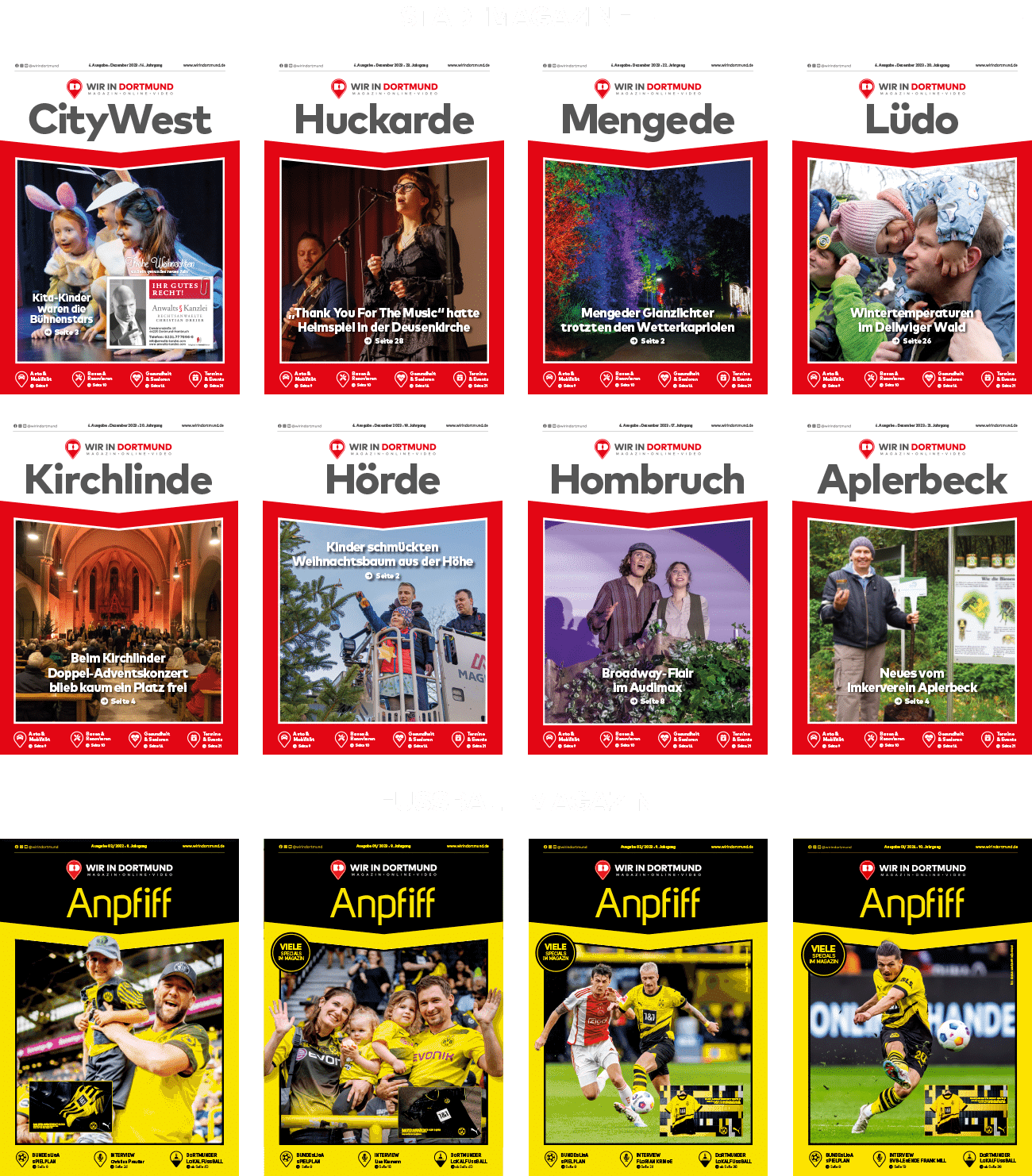Valérie Raillon räumt ab. Nachdem die heutige Neuntklässlerin des Goethe-Gymnasiums im vergangenen Jahr den ersten Preis beim schulinternen „Goethe-Gymnasium“ mit nach Hause genommen hatte, musste sie sich 2023 hinter Rebecca Weber einreihen. Auf Landesebene jedoch betrachtet man sie ab sofort als erstklassig. Und da ist noch mehr drin.
Eine kleine Messe in der Schulaula
Während das Gymnasium die Goethe-Genius-Gala im letzten Jahr per Videokonferenz durchgeführt hatte, konnten die Teilnehmenden dieses Mal konkret zeigen, was sie im vergangenen halben Jahr erarbeitet hatten. In der Aula bauten alle Goethe-Genius-Anwärter:innen ihren jeweiligen Stand auf, berichtet Lehrer Heiko Nüllmann als Mitorganisator des Wettbewerbs: „Da konnte man was anfassen, da konnte man was sehen.“
Philipp Birkner: Einsatzmöglichkeiten von Solartechnik
So hatte Philipp Birkner die Solarzelle mitgebracht, die sein Patenonkel ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Indem er ein Eckchen abdeckte, wies er nach, „was sowas Kleines eigentlich ändert“. Liefert die Solarzelle im sauberen Zustand fünf Watt, kam nun nicht einmal ein Fünftel davon an. Dies jedoch ist nur eine von vielen Experimenten und Analysen, die Philipp seit Dezember vorrangig in seiner Freizeit durchgeführt hatte, um herauszufinden, welche Einsatzmöglichkeiten für eine Solarzelle möglich sind.
„Dann habe ich ein Gedankenspiel gemacht, ob Solarzellen auf Autos Sinn machen.“ Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass die Kosten für die notwendigen Solarzellen den Nutzen deutlich übersteigen würden, liefert eine Solarzelle doch lediglich Strom für ein Vierundzwanzigstel des Stromverbrauchs eines PKW. Für Geschwindigkeitsdisplays jedoch empfiehlt der 13-Jährige Einsatz von Photovoltaik ausdrücklich. Mit seinem Projekt erkämpfte Philipp sich den ersten Preis der Klassen Fünf bis Sieben, die die Lehrkräftejury in diesem Jahr zum ersten Mal isoliert in den Blick nahm.
Rebecca Weber: Bioprinting – gibt es bald Organe aus dem 3D-Drucker?
Als Vertreterin der höheren Klassen überzeugte Rebecca Weber „mit der Frage, ob es in der Zukunft Organe aus dem 3D-Drucker geben wird“, am meisten. Ein Kollege ihres Vaters hatte sie zu diesem Thema gebracht, nicht aktiv, sondern indem er auf ein Spenderherz wartete: Rebecca begann zu recherchieren.
Dabei stieß die 14-Jährige auf den Begriff des Bioprintings und fand heraus, dass Gewebestrukturen und Knochen bereits jetzt gedruckt werden können. „Zum Drucken züchtet man Zellen“, erklärt Rebecca. Diese werden anschließend zu einer Zellflüssigkeit verarbeitet, die der Drucker „immer Schicht für Schicht“ aufbringt, um am Ende ein fertiges Organ herzustellen. Ein optisch dem Original entsprechendes, aber noch nicht funktionsfähiges Herz erstellten Forschende laut Frankfurter Rundschau im Jahr 2019. Wann es nun möglich sein wird, auf das Spenderorgan zu verzichten, kann Rebecca, die hierzu auf sehr unterschiedliche Aussagen gestoßen ist, nicht sagen: „Die Zukunft ist da auf jeden Fall sehr offen.“
Valérie Raillon: Vom Wohnraum zur Halde – die Kolonie Felicitas im Wandel der Zeit
Ebenso wie Philipp hat Rebecca für ihre Nachforschungen vorrangig ihre Freizeit genutzt. Valérie hingegen war das nicht möglich, war sie doch an die Öffnungszeiten des Landesarchivs Münster und des Hoesch-Archivs in Duisburg gebunden. Natürlich musste sie auch die Wege dorthin zurücklegen, wozu sie unter anderem zweimal wöchentlich der Goethe-Genius-Ausweis berechtigte. Den Ausschlag für diese kleinen Reisen hatte im Prinzip ihre Hündin Paula gegeben, mit der Valérie regelmäßig auf der Halde zwischen Entenpoth und Phoenix West unterwegs ist: „Da kann man schön mit dem Hund gehen und da trifft man auch Leute“ – Leute, die teilweise einmal dort wohnten, wo sie nun spazierengingen, und der Vierzehnjährigen davon erzählten.
Bis in die späten Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts befand sich hier die Siedlung Felicitas, Hördes zweite Arbeiterkolonie nach dem Clarenberg. 37 Gebäude à vier Parteien hatte Hoesch für seine Arbeiter und ihre Familien errichtet. Mehrere Hundert Menschen kamen hier unter, berichtet Valérie aus ihren Recherchen: „Der Wohnraum war gut ausgelastet.“
Doch im Jahre 1974 griff ein Abstandserlass in die Leben der Familien ein, denn mit Inkrafttreten dieses Papiers wurde die Siedlung Felicitas in unmittelbarer Umgebung des Hochofens unzulässig, weshalb man den Abriss der Häuser forcierte. Mit Händen und Füßen wehrten sich die Menschen, weiß Valérie unter anderem aus besagten Gassi-Gesprächen: „Mir haben tatsächlich mehrere Leute erzählt, sie wären die letzten gewesen, die da ausgezogen sind.“ Dennoch verschwand die Siedlung bis 1979 vollständig unter dem Einfluss des Abrisshammers.
Erfolge und Chancen
Anhand einer Punktevergabe für den Präsentationstisch und den Vortrag zum Thema, den alle Teilnehmenden Anfang Mai beim Goethe-Genius hielten, wurde es möglich, diese Arbeit mit der Biologiearbeit von Rebecca zu vergleichen. Letztere kam auf einige Teilpunkte mehr und darf sich nun Goethe-Genius 2023 nennen. Was Valérie betrifft, brachte sie es an anderer Stelle zum Erfolg. Der Landessieg im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gehört nun ihr – und damit 500 Euro und eine Einladung zur Preisverleihung in Bonn. Darüber hinaus begutachtet man ihre Arbeit nun auf noch höherer Ebene, was für Valérie die Chance auf einen von 50 Bundespreisen bedeuten, die im November verliehen werden.